Büste Christian
Friedrich Daniel Schubart in Aalen entdeckt:
Mit seinen hübschen
Klavier-Schülerinnen
verband ihn mehr als nur die Liebe zur Musik
Museumsreferentin Heidrun Heckmann wurde
nun im Haus der
Stadtgeschichte fündig: Bis 1787auf der Festung Hohenasperg

Besser als
Fotografie oder rostiges Denkmal vor dem Aalener Haupt-bahnhof: Im Haus der
Stadtgeschichte in Aalen hat nun H. Heck-mann Büste Christian Friedrich
Daniel Schubart in selbst entdeckt.
Aalen.
Die Büste von Christian Friedrich Daniel Schubart ist der Museumsfund des
Monats Januar, den die Museumsreferentin des Ostalbkreises Heidrun Heckmann
im Aalener Haus der Stadtgeschichte gemacht hat. Das im März 2008 eröffnete
Haus der Stadtgeschichte wurde in einer ehemalige Aussegnungshalle des
späten 19. Jahrhunderts eingerichtet. Wer mehr über Schubart und dieses
Museum erfahren möchte, findet die Antworten unter
www.ostalbkreis.de
beim aktuellen Museumsfund des Monats. Hier berichten auch die vorherigen
Museumsfunde von den reichhaltigen Sammlungen der Museen im Ostalbkreis.
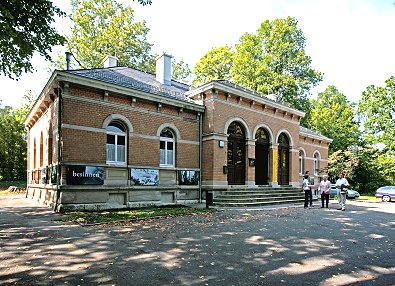
Das Aalener
"Haus der Stadtgeschichte". AIZ-Fotos: D. Geissbauer
Heute ist von Fotografien bekannt, wie jemand aussieht oder aus-gesehen hat.
Aus Zeiten, in denen es noch keine Fotografie gab, kann das Aussehen einer
Person nur durch Gemälde oder Skulpturen überliefert werden. Ob hierbei dem
Dargestellten ge-schmeichelt wurde oder ob die Person tatsächlich so
ausgesehen hat, kann man daher nur vermuten. Vergleicht man jedoch die
Gemälde, Radierungen und Skulpturen von Christian Friedrich Daniel Schubart,
so ergibt sich ein einheitliches Bild des Dichters, Jour-nalisten und
Musikers, der vor allem auch als Rebell in Erinnerung geblieben ist.
Geboren ist er am 26. März 1739 in Obersontheim und verbrachte seine frühe
Kindheit in Aalen. Da er beruflich in die Fußstapfen des Vaters – einem
Pfarrer – treten sollte, schickte man ihn nach Jena zum Theologiestudium. Er
blieb aber schon in Erlangen hängen, wo er weniger als ernsthafter Student,
sondern eher als fröhlicher Zecher auffiel. Ohne Abschluss kehrte er nach
Aalen zurück und arbeitete als Hilfs- und Aushilfsprediger seine im Studium
entstandenen Schulden bei der Stadt Aalen ab.
Mit der Stelle des Schulmeisters und Organisten in Geislingen stellte sich
eine vermeintliche Solidität bei ihm ein, er heiratete und gründete eine
Familie. In Wirklichkeit hasste er sein Dasein in Geis-lingen. Sein
Kommentar „Ein Schulmeister? O behüt’s Gott! Lieber bei Wasser und Brot ins
Zuchthaus als sein Lebtag menschliche Säu hüten!"
Die neue Stelle als Organist und Musikdirektor in Ludwigsburg em-pfand er
daher als Befreiung. Bald waren die Weinstuben und Gast-häuser sein zweites
Zuhause und mit einigen seines Klavier-schülerinnen verband ihn mehr als nur
die Liebe zur Musik. Seinem Vorgesetzten Dekan Zilling war er daher ein Dorn
im Auge und er setzte sich für seine Entfernung aus Ludwigsburg ein. Mit
herzoglichem Erlass wurde er im Jahr 1773 des Landes verwiesen.
Die Odyssee begann: Heilbronn, Mannheim, Heidelberg, Schwetz-ingen waren
erste Stationen. Er sagte über seine Wanderschaft: „Meine Seele suchte und
fand nicht." Dann Aschaffenburg, Darmstadt, Würzburg, München und Augsburg.
Hier verwirklichte er die Idee zu seiner Deutschen Chronik, die als
Wochenblatt erschien und als solches eines der ersten seiner Art in
Deutschland war. Seine unverhohlene Kritik an Obrigkeit und Klerus vertrieb
ihn auch aus Augsburg. Er kam nach Ulm und schrieb weiter freche Artikel für
die Deutsche Chronik: Die herzogliche Militärakademie bezeichnete er als
Sklavenplantage, die künftige Herzogin Franziska von Hohenheim als Donna
Schmergelina. Das Maß war voll: Von 1777 bis 1787 saß er auf der Festung
Hohenasperg in Haft, teilweise sogar in zermürbender Einzelhaft.
Nach der Entlassung wurde er rehabilitiert und bekleidetet das Amt als
Hofdichter und Theaterdirektor in Stuttgart. Von der Haft jedoch stark
geschwächt, waren ihm nur wenige Jahre in Freiheit vergönnt. Er starb am 18.
Oktober 1791. Sein Grab auf dem Stuttgarter Hoppenlaufriedhof ist nicht
bekannt. Die Büste im Haus der Stadtge-schichte zeigt ihn schon im reiferen
Alter.